Piriformis-Syndrom: Symptome, Diagnose, Behandlung
Für die Behandlung des Piriformis-Syndroms stehen verschiedenste nicht operative Maßnahmen zur Verfügung: Sie reichen von Dehnungsübungen bis hin zu Infiltration mit Botox. Die Wirksamkeit hängt meist vom Schweregrad der Erkrankung ab. In hartnäckigen Fällen kann eine Operation notwendig werden.
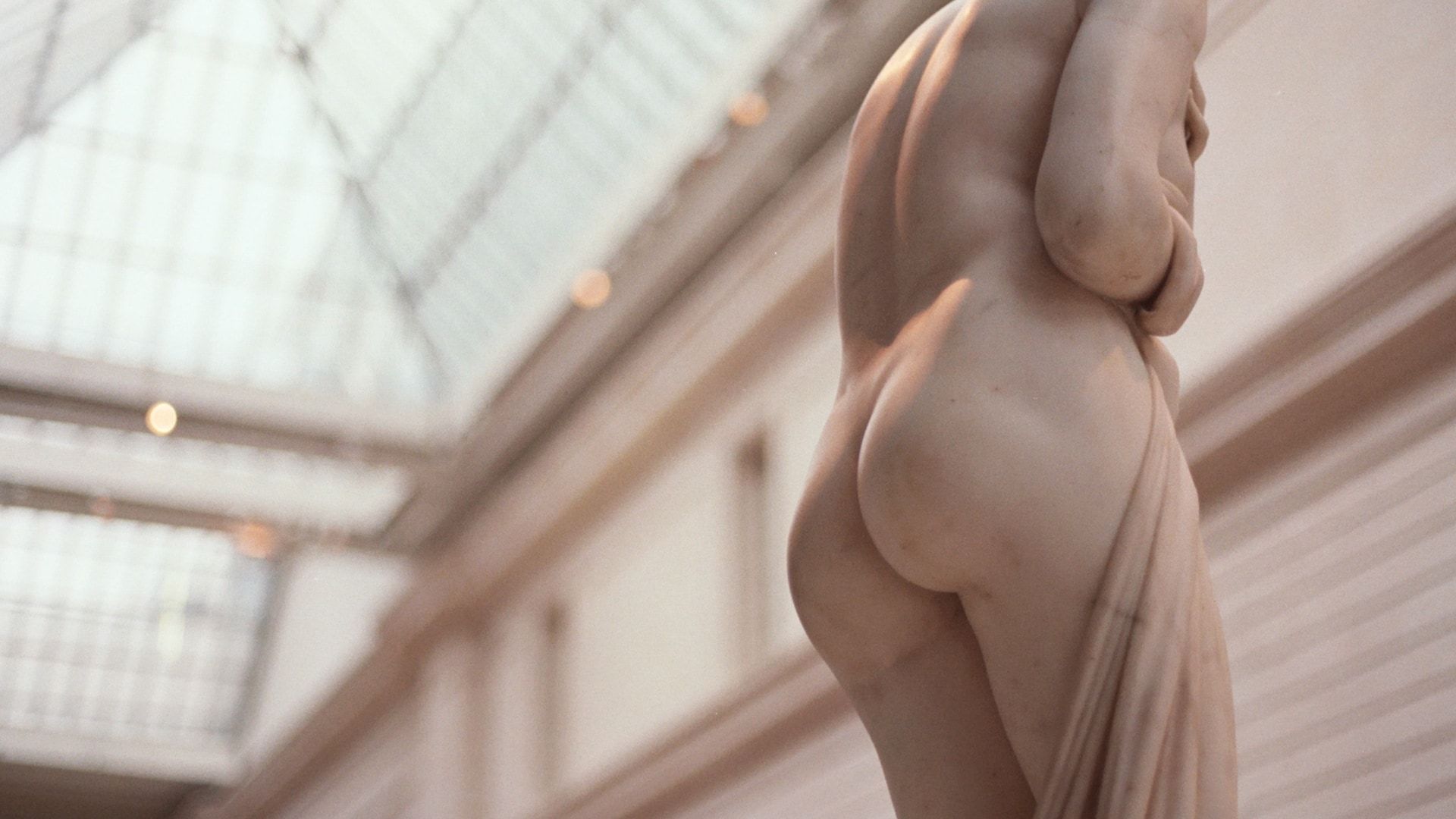
Was ist ein Piriformis-Syndrom?
Das Piriformis-Syndrom äußert sich meist durch Schmerzen und Gefühlsstörungen im Gesäß, welche in die Hüfte sowie in den hinteren Oberschenkel und bis in die Füße ausstrahlen können. Da diese Symptome auch durch andere Erkrankungen (z. B. Bandscheibenvorfall) ausgelöst werden können, ist die umfassende Abklärung zu Beginn einer Behandlung entscheidend. Die Therapie des Piriformis-Syndroms basiert in der Regel auf konservativen (nicht operativen) Mitteln.
Der Piriformis-Muskel ist einer der tiefen Gesäßmuskeln. Er ist ein dicker, birnenförmiger (daher auch sein Name) Skelettmuskel. Im kleinen Becken entspringt er dem Steißbein und zieht von dort nach außen bis zum Oberschenkelknochen. Der Muskel ist hauptsächlich für die Außendrehung und Abspreizung des Oberschenkels verantwortlich. Er ist eine wichtige Leitstruktur für alle Nerven und Gefäße, die zwischen Becken und Oberschenkel verlaufen. Durch seine Funktion und Position neigt er zu Verkürzung und Verspannung - die Ausgangssituation für die Entstehung eines Piriformis-Syndroms. Die Beschwerden können sowohl muskulärer als auch neuropathischer Natur sein: Der Schmerz kann einerseits im verspannten Muskel selbst entstehen und andererseits dadurch, dass der Muskel den nahegelegenen Ischiasnerv bedrängt.
Das Piriformis-Syndrom ist meist kein isoliertes Erkrankungsbild, da mehrere Strukturen im Gesäß daran beteiligt sein können, wenn der Ischiasnerv schmerzhaft bedrängt wird. Es sei erwähnt, dass in der Medizin immer noch Uneinigkeit darüber herrscht, ob das Piriformis-Syndrom als solches überhaupt existiert. Aus diesem Grund wird heute der Begriff „Tiefes Gesäßsyndrom“ (Deep Gluteal Pain Syndrome) anstelle des „Piriformis-Syndroms“ bevorzugt, um das Vorhandensein von Schmerzen im Gesäß zu beschreiben, die nicht durch einen Bandscheibenvorfall oder eine Einklemmung des Ischiasnervs außerhalb des Beckens verursacht werden.
Was sind die Ursachen eines Piriformis-Syndroms?
Dem Piriformis-Syndrom liegt meist eine Verkürzung oder Verspannung des Piriformis-Muskels zugrunde. Die Ursachen dafür können langes Sitzen, schlechte Körperhaltung, zurückliegende Verletzungen im Gesäßbereich oder Überlastung - etwa durch Tätigkeiten in vorgebeugter Haltung - sein. (Als sehr unvorteilhaft gilt auch häufiges Sitzen auf der Geldbörse, da hier besonderer Druck auf den M. Piriformis entsteht.) Verhärtet der Muskel, so übt dieser häufig auch Druck auf den Ischiasnerv aus. Hierbei können auch anatomische Varianten eine entscheidende Rolle spielen: Bei manchen Menschen verläuft ein Teil des Ischiasnervs durch den Piriformismuskel hindurch - ein klare Prädisposition für die Entstehung der Beschwerden.
Was sind die Symptome eines Piriformis-Syndroms?
Die Beschwerden, die mit dem Piriformis-Syndrom einhergehen, können sich sowohl muskulär als auch neuropathisch zeigen. Vorrangig macht sich die Erkrankung durch starke Schmerzen im Gesäß bemerkbar, die sich beim Sitzen häufig verstärken. Die Schmerzen können in Hüfte, Oberschenkel-Rückseite und bis in den Fuß ausstrahlen und mit Gefühlsstörungen (z. B. Kribbeln, Taubheit) einhergehen. Ebenfalls möglich sind Rückenschmerzen und sexuelle Funktionsstörungen. Kniebeugen, Sitzen auf harter Unterlage (oder auf der Geldbörse) und Belastungen wie langes Stehen, Laufen, Heben oder Vornüberbeugen hingegen verschlimmern die Schmerzen typischerweise..
Wie wird die Diagnose gestellt?
Die Diagnose des Piriformis-Syndroms erfolgt weitgehend klinisch unter Berücksichtigung diverser Ausschlussdiagnosen wie z. B. Bandscheibenvorfall, Facettenarthropathie, Spinalkanalstenose. Patient:innen geben in der Regel Schmerzen im Gesäß mit oder ohne Ausstrahlung in den hinteren Oberschenkel an. Der Schmerz verschlimmert sich typischerweise bei Aktivität, längerem Sitzen oder Gehen. Unter Umständen humpeln Patient:innen oder halten das Bein in Rückenlage in verkürzter und nach außen gedrehter Position. Tastuntersuchungen (z. B. der großen Ischiaskerbe und des Piriformismuskels) können als sehr unangenehm empfunden werden. Eine neuromuskuläre Untersuchung sollte ebenfalls durchgeführt werden. Werden Schwäche oder Sensibilitätsverluste festgestellt, wird die Diagnose Piriformis-Syndrom unwahrscheinlicher – die Ausnahme hierbei sind chronische Fälle, in denen eine sekundäre Muskelatrophie vorliegt. Des Weiteren sollten provokative, körperliche Untersuchungsmanöver zum Einsatz kommen, um die Diagnose sicherzustellen: die Freiberg-, Pace-, FAIR-, Beatty- oder HCLK-Manöver.
Wie kann man dem Piriformis-Syndrom vorbeugen?
Die Schmerzbeschwerden haben ihren Ursprung in der Anspannung des M. Piriformis bzw. in der daraus folgenden Irritation des Ischiasnervs. Unvorteilhafte Einflüsse, die ebendiese Verspannung und den Druck auf den Nerv fördern, können mit einfachen Maßnahmen reduziert werden: Vermeiden Sie langes, einseitiges Sitzen bzw. stehen Sie alle 20 Minuten kurz auf und gehen ein Stück. Pausieren Sie bei langen Autofahrten regelmäßig und vertreten Sie sich die Beine. Vermeiden Sie Tätigkeiten, bei denen eine hohe Verletzungsgefahr für die Gesäßregion besteht. Tägliches Stretching und Kräftigung der Muskelgruppen in der Gesäßregion werden empfohlen, um Schmerzen zu reduzieren und ein (Wieder-)Auftreten zu verhindern.
Wie wird ein Piriformis-Syndrom am besten behandelt?
Konservative Behandlungsmethoden können beim Piriformis-Syndrom häufig eine langfristige Linderung erzielen. Verhaltensänderungen und Übungen spielen hier eine besonders wichtige Rolle. Sind Übungen aufgrund von Schmerzen nicht möglich, so können schmerzlindernde und/oder muskelrelaxierende Medikamente helfen. Auch Infiltrationen (z. B. mit Botox) oder in weiterer Folge, chirurgische Verfahren, können zum Einsatz kommen. Hier ein Überblick über die Behandlungsoptionen:
- Übungen
- Physiotherapie
- Schmerzmittel oral (NSAR)
- Muskelrelaxanzien
- Antikonvulsiva
- Stoßwellen-Therapie
- Botox-Infiltration
- Kortison-Infiltration
- Dry Needling
- Operation
- Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome, diagnosis and treatment. Muscle Nerve. 2009 Jul;40(1):10-8. doi: 10.1002/mus.21318. PMID: 19466717.
- Fishman LM, Anderson C, Rosner B. BOTOX and physical therapy in the treatment of piriformis syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 2002 Dec;81(12):936-42. doi: 10.1097/00002060-200212000-00009. PMID: 12447093.
- Terlemez R, Erçalık T. Effect of piriformis injection on neuropathic pain. Agri. 2019 Nov;31(4):178-182. English. doi: 10.14744/agri.2019.34735. PMID: 31741344.
- Hicks BL, Lam JC, Varacallo M. Piriformis Syndrome. 2021 Jul 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 28846222.
- Papadopoulos EC, Khan SN. Piriformis syndrome and low back pain: a new classification and review of the literature. Orthop Clin North Am. 2004 Jan;35(1):65-71. doi: 10.1016/S0030-5898(03)00105-6. PMID: 15062719.
- Vij N, Kiernan H, Bisht R, Singleton I, Cornett EM, Kaye AD, Imani F, Varrassi G, Pourbahri M, Viswanath O, Urits I. Surgical and Non-surgical Treatment Options for Piriformis Syndrome: A Literature Review. Anesth Pain Med. 2021 Feb 2;11(1):e112825. doi: 10.5812/aapm.112825. PMID: 34221947; PMCID: PMC8241586.
- Jankovic D, Peng P, van Zundert A. Brief review: piriformis syndrome: etiology, diagnosis, and management. Can J Anaesth. 2013 Oct;60(10):1003-12. doi: 10.1007/s12630-013-0009-5. Epub 2013 Jul 27. PMID: 23893704.
- Tabatabaiee A, Takamjani IE, Sarrafzadeh J, Salehi R, Ahmadi M. Ultrasound-guided dry needling decreases pain in patients with piriformis syndrome. Muscle Nerve. 2019 Nov;60(5):558-565. doi: 10.1002/mus.26671. Epub 2019 Aug 27. PMID: 31415092.
- Han SK, Kim YS, Kim TH, Kang SH. Surgical Treatment of Piriformis Syndrome. Clin Orthop Surg. 2017 Jun;9(2):136-144. doi: 10.4055/cios.2017.9.2.136. Epub 2017 May 8. PMID: 28567214; PMCID: PMC5435650.
- Probst D, Stout A, Hunt D. Piriformis Syndrome: A Narrative Review of the Anatomy, Diagnosis, and Treatment. PM R. 2019 Aug;11 Suppl 1:S54-S63. doi: 10.1002/pmrj.12189. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31102324.
- Robertson K, Marshman LA, Plummer D. Pregabalin and gabapentin for the treatment of sciatica. J Clin Neurosci. 2016 Apr;26:1-7. doi: 10.1016/j.jocn.2015.05.061. Epub 2015 Nov 26. PMID: 26633090.
- https://orthoinfo.org/en/recovery/hip-conditioning-program/hip-pdf/
- https://www.nhs.uk/live-well/exercise/exercises-sciatica-problems/

